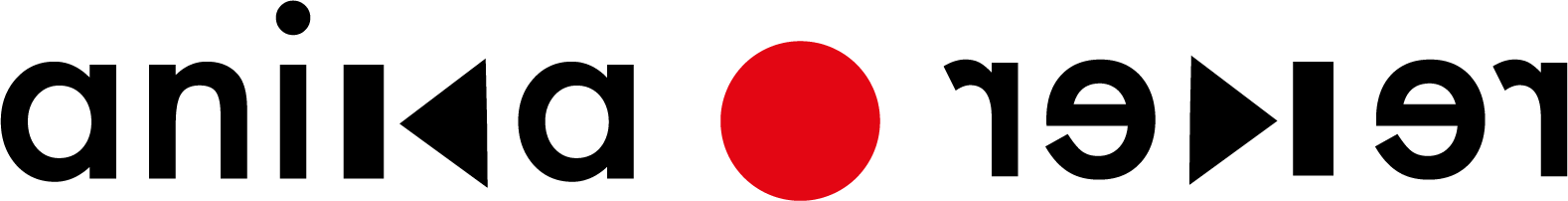Marokkos Generation Y sechs Jahre nach dem arabischen Frühling
Im März diesen Jahres hat der Bundesrat abgelehnt, Marokko zusammen mit Algerien und Tunesien als sicheres Herkunftsland einzustufen. Denn auch wenn das Land als stabilstes unter den Maghreb-Staaten gilt und zum beliebten Ziel für Rucksackreisende geworden ist, prangern Menschenrechtsorganisationen weiter Folter und die Unterdrückung von Minderheiten an. Vor allem Frauen, Homosexuellen und Oppositionelle haben es schwer im Königreich Marokko. JETZT hat junge Menschen getroffen, die seit dem arabischen Frühling im Jahr 2011 gegen den Status Quo in ihrer Heimat aufbegehren und dabei immer wieder mit den staatlichen Autorität in Konflikt geraten.
von Anika Reker
In einem großen Raum mit stechendem Neonlicht im Kulturzentrum Dar Saida in Marrakesch sitzen etwa zwanzig junge Leute in kleinen Grüppchen um je ein Flipchart. Es ist Samstagnachmittag und draußen scheint die Sonne, währen drinnen lebhaft über die Doku Beyond Borders aus dem Jahr 1999 diskutiert wird. Kurz zuvor flimmerte der Film über Feminismus in Nordafrika und im nahen Osten über die kahle, weißen Tapete im Raum. „An der Situation von Frauen hat sich hier doch nichts geändert, eher verschlechtert,“ wirft Amina Terrass mit funkelndem Blick in die Runde. Die charismatische 27-Jährige ist Vorsitzende der örtlichen USCE-Gruppe, einer studentischen Vereinigung, die für einen Wandel des marokkanischen Bildungssystems kämpft und in insgesamt acht größeren Städten des Landes vertreten ist.
„Kritisches Denken steht in Marokko nicht in den Bildungsplänen. Stattdessen wird Wissen von oben herab diktiert,“ erklärt Amina später. Deshalb organisiere USCE einmal wöchentlich sogenannte „Popular Universities“, um Studierenden eine hierarchiefreie Alternative zu dem anzubieten, was sonst in den überfüllten Hörsälen der Universitäten im Land vermittelt wird. In Workshops könne jeder sein Wissen einbringen und von dem der anderen profitieren. Wegen des Film-Screenings fand das heutige Treffen drinnen statt. In der Regel versuchen die Studierenden aber ihre Aktionen in Fußgängerzonen oder in Parks abzuhalten. „Mit Straßen-Philosophie wollen wir öffentliche Plätze zurückerobern,“ sagt Amina. Häufig gerieten die AktivistInnen dabei mit der Polizei aneinander. Aber auch das Anmieten von offiziellen Konferenzräumen würden die staatlichen Autoritäten so gut es geht unterbinden. „Es passiert oft, dass die Polizei vor uns an den Veranstaltungsorten ist und die Vermieter einschüchtert, sodass wir alles ablasen müssen,“ sagt Amina.
 Großen Spielraum dem Staat gegenüber haben die Studenten nicht, denn offiziell gilt USCE als verbotene Organisation. „Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass viele Aktivisten aus der Bewegung des 20. Februar der Gruppe angehören,“ sagt der Fotograf und Filmemacher Nadir Bouhmouch. Dabei meint er das marokkanische Pendant zum Arabischen Frühling, unter dessen Banner im Jahr 2011 viele junge Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen waren. Der heute 26-Jährige drehte damals eine Doku über die Rolle seiner Generation und ging der Frage nach, warum die Protestbewegung sich so schnell mit der vom König verabschiedeten Verfassungsreform zufrieden gegeben hatte. Nadir und den meisten anderen USCE-AktivistInnen gingen die Änderungen damals nicht weit genug, weshalb sie sich weiter für politischen und gesellschaftlichen Wandel einsetzen.
Großen Spielraum dem Staat gegenüber haben die Studenten nicht, denn offiziell gilt USCE als verbotene Organisation. „Sehr wahrscheinlich liegt es daran, dass viele Aktivisten aus der Bewegung des 20. Februar der Gruppe angehören,“ sagt der Fotograf und Filmemacher Nadir Bouhmouch. Dabei meint er das marokkanische Pendant zum Arabischen Frühling, unter dessen Banner im Jahr 2011 viele junge Menschen für mehr Demokratie auf die Straße gegangen waren. Der heute 26-Jährige drehte damals eine Doku über die Rolle seiner Generation und ging der Frage nach, warum die Protestbewegung sich so schnell mit der vom König verabschiedeten Verfassungsreform zufrieden gegeben hatte. Nadir und den meisten anderen USCE-AktivistInnen gingen die Änderungen damals nicht weit genug, weshalb sie sich weiter für politischen und gesellschaftlichen Wandel einsetzen.
„Einer der Gründe, warum die Revolution so schnell im Sand verlaufen ist, ist unser Bildungssystem. Menschen lernen hier einfach nicht, selbstständig zu denken,“ glaubt Nadir und rückt dabei das rot-weiße Palästinensertuch zurecht, dass er sich locker um die wuscheligen Haaren gebunden hat. Durch die oberflächlichen Reformen sei es dem Staat gelungen, ein demokratisches Image aufrecht zu erhalten, das internationalen Geldgebern und Konzernen bis heute das Gefühl gibt, in einen stabilen Staat zu investieren.
Umgang mit Oppositionellen: „Wenn du jemals in deinem Leben die Sonne wieder siehst, kannst du ja kommen und mir ins Gesicht scheißen“
 „Marokko ist ein sicheres Land für Touristen. Für die Menschen, die hier leben, ist es schwierig. Besonders für Frauen und junge Leute,“ sagt Fatima Zahra Faiz. Wie es tatsächlich hinter der schönen Fassade aussieht, hat die 29-Jährige am eigenen Leib erfahren. Nach der Film-Vorführung mit anschließender Diskussion vermittelt sie in einem abgeschiedenen Innenhof einer alten Riad im Stadtzentrum einen Eindruck davon, wie die marokkanische Polizei mit politischen Gefangenen umgeht. „Sie haben uns all unsere Kleider abgenommen, beleidigten und schlugen uns“, erinnert sich die Philosophiestudentin bei vielen Zigaretten und einer Kanne Minztee an den Tag, an dem sie während einer offiziell angemeldeten Demonstration in Marrakesch verhaftet und zunächst fünf Tage gemeinsam mit einer Freundin auf der örtlichen Polizeistation festgehalten wurde. Es war der 23. Februar 2011. In ihren Bericht trugen die Beamten allerdings den Folgetag ein, an dem keine Demonstration genehmigt worden war. So lag ein Straftatbestand wegen unerlaubten Protests gegen die damals 22-Jährige vor.
„Marokko ist ein sicheres Land für Touristen. Für die Menschen, die hier leben, ist es schwierig. Besonders für Frauen und junge Leute,“ sagt Fatima Zahra Faiz. Wie es tatsächlich hinter der schönen Fassade aussieht, hat die 29-Jährige am eigenen Leib erfahren. Nach der Film-Vorführung mit anschließender Diskussion vermittelt sie in einem abgeschiedenen Innenhof einer alten Riad im Stadtzentrum einen Eindruck davon, wie die marokkanische Polizei mit politischen Gefangenen umgeht. „Sie haben uns all unsere Kleider abgenommen, beleidigten und schlugen uns“, erinnert sich die Philosophiestudentin bei vielen Zigaretten und einer Kanne Minztee an den Tag, an dem sie während einer offiziell angemeldeten Demonstration in Marrakesch verhaftet und zunächst fünf Tage gemeinsam mit einer Freundin auf der örtlichen Polizeistation festgehalten wurde. Es war der 23. Februar 2011. In ihren Bericht trugen die Beamten allerdings den Folgetag ein, an dem keine Demonstration genehmigt worden war. So lag ein Straftatbestand wegen unerlaubten Protests gegen die damals 22-Jährige vor.
 Die fünf Tage auf der Polizeiwache seien schlimmer gewesen, als die drei Monate, die sie danach im Gefängnis verbrachte. Wasser und Essen habe man ihnen kaum gegeben und schon gar nicht die Möglichkeit, sich zu waschen, erzählt Fatima weiter. „Für meine Freundin, die in der Zeit auch noch ihre Tage hatte, war das extrem unangenehm. Sie haben sie einfach bluten lassen.“ Mitten in der Nacht sei sie von den Beamten immer wieder geweckt und mit Fragen gelöchert worden. Sie zeigten ihr Fotos, auf denen sie Monate zuvor mit Freunden in Cafés zu sehen war. Mit Drohungen wie „Wenn du jemals in deinem Leben die Sonne wieder siehst, kannst du ja kommen und mir ins Gesicht scheißen,“ habe man versucht, sie einzuschüchtern und dazu zu bringen, Namen von Gleichgesinnten preiszugeben.
Die fünf Tage auf der Polizeiwache seien schlimmer gewesen, als die drei Monate, die sie danach im Gefängnis verbrachte. Wasser und Essen habe man ihnen kaum gegeben und schon gar nicht die Möglichkeit, sich zu waschen, erzählt Fatima weiter. „Für meine Freundin, die in der Zeit auch noch ihre Tage hatte, war das extrem unangenehm. Sie haben sie einfach bluten lassen.“ Mitten in der Nacht sei sie von den Beamten immer wieder geweckt und mit Fragen gelöchert worden. Sie zeigten ihr Fotos, auf denen sie Monate zuvor mit Freunden in Cafés zu sehen war. Mit Drohungen wie „Wenn du jemals in deinem Leben die Sonne wieder siehst, kannst du ja kommen und mir ins Gesicht scheißen,“ habe man versucht, sie einzuschüchtern und dazu zu bringen, Namen von Gleichgesinnten preiszugeben.
In einer der Nächte hätten die Beamten sie dazu gezwungen, sich nackt auf den Boden zu legen. Man befahl ihr sich vorzustellen, dass sie mit ihrem Freund schlafen würde. Derartige sexuelle Erniedrigungen und extreme psychologische Gewalt, wie Fatima sie erfahren hat, gehören laut Amnesty International bis heute zu den gängigen Foltermethoden, die in Marokko angewendet werden, um den Widerstand von politischen AktivistInnen zu brechen. Allein zwischen 2010 und 2014 verzeichnete die Organisation 173 solcher Fälle.
Obwohl Fatima sich fast sieben Jahre nach ihrer Haft noch immer beobachtet fühlt, kämpft sie weiter aktiv für die Rechte von Frauen und Minderheiten. Regelmäßig nimmt sie an Aktionen von USCE und an politischen Demonstrationen teil. „Ich habe Prinzipien, die ich nicht loslassen kann und ich bin bereit, für meine Freiheit einen gewissen Preis zu zahlen. Notfalls auch den, wieder im Gefängnis zu landen,“ sagt sie mit fester Stimme und schüttelt dabei selbstbewusst ihren krausen Lockenkopf.
Bis zu drei Jahre Gefängnis und 1.500 Dislikes für Homosexualität
 Ähnlich sieht das auch Hajar Moutaouakil. Vor drei Jahren gründete die 24-Jährige Akaliyat, das ersten Online-Magazin Marokkos, welches sich explizit queeren Themen widmet. Hajar ist lesbisch und bekennt sich offen dazu, obwohl Homosexualität nach dem marokkanischen Strafgesetzbuch (§ 489) mit Gefängnisbußen von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Mit der Botschaft, dass Liebe kein Verbrechen ist, wandte Hajar sich Ende 2015 in einem Video mit ihrem vollen Namen an die Öffentlichkeit. Damit habe sie damals in den sozialen Netzwerken ziemlich viel positive wie auch negative Aufmerksamkeit bekommen. Aktuell hat der Clip bei Youtube 1.500 Dislikes, denen gerade mal 500 positive Bewertungen gegenüberstehen. „Menschen sehen Homosexualität hier immer noch als Sünde. Die Regierung muss dringend die Gesetze ändern, damit der gesellschaftliche Prozess zu mehr Toleranz schneller in Gang kommt,“ sagt Hajar.
Ähnlich sieht das auch Hajar Moutaouakil. Vor drei Jahren gründete die 24-Jährige Akaliyat, das ersten Online-Magazin Marokkos, welches sich explizit queeren Themen widmet. Hajar ist lesbisch und bekennt sich offen dazu, obwohl Homosexualität nach dem marokkanischen Strafgesetzbuch (§ 489) mit Gefängnisbußen von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Mit der Botschaft, dass Liebe kein Verbrechen ist, wandte Hajar sich Ende 2015 in einem Video mit ihrem vollen Namen an die Öffentlichkeit. Damit habe sie damals in den sozialen Netzwerken ziemlich viel positive wie auch negative Aufmerksamkeit bekommen. Aktuell hat der Clip bei Youtube 1.500 Dislikes, denen gerade mal 500 positive Bewertungen gegenüberstehen. „Menschen sehen Homosexualität hier immer noch als Sünde. Die Regierung muss dringend die Gesetze ändern, damit der gesellschaftliche Prozess zu mehr Toleranz schneller in Gang kommt,“ sagt Hajar.
Aufbruch des gesellschaftlichen Korsetts: „Marokko muss seinen eigenen Weg finden und gehen“
Dass sich nicht nur vieles im poltischen System, sondern auch in der Gesellschaft ändern muss, sagt auch Filmemacher Nadir. Seiner Meinung nach muss Marokko dabei aber einen eigenen Weg finden und gehen. Der 26-Jährige, der ein Semester in Kalifornien studierte, hält nicht viel davon, wenn westliche Organisationen im Alleingang Dinge verbessern wollen und ihre Vorstellungen von oben aufdrücken. „In Europa und den USA geht man davon aus, dass wir hier alle queere Menschen hassen und Frauen verachten,“ sagt Nadir. Homophobie würde immer nur im religiösen Zusammenhang gesehen. Dabei trage der Islam die Schuld. Dadurch würde die Möglichkeit, gleichzeitig schwul und gläubig zu sein, bereits im Kern erstickt. Queeren und gläubigen Marokkanern würde so der Raum genommen, sich auf ihre Weise aus gesellschaftlichen Zwängen zu befreien.
Die Autoren von Akaliyat schreiben mittlerweile nicht nur über die Belange von Minderheiten, sondern setzten sich auch aktiv dafür ein. Die Gruppe zählt nach eigenen Angaben in Marokko – und auch im Exil in Frankreich, Spanien und den USA – etwa 200 Mitglieder. Gerne würden sie eine richtige NGO gründen, um Spenden von internationalen Unterstützern sammeln zu können. Bisher machen die staatlichen Behörden aber, wie bei USCE, einen Strich durch diese Rechnung.
In Méknes und Rabat hätten einige Mitglieder von Akaliyat bereits Besuch von der Polizei bekommen, erzählt Hajar. Die Beamten hätten versucht, die Leute dazu zu drängen, die Organisation zu verlassen. Dafür wurden sie vor ihren Familien, die oft nichts von den Aktivitäten geschweige denn der Homosexualität ihrer Kinder mit unangenehmen Fragen gelöchert. „Die Betroffenen sind trotzdem bei uns geblieben und schreiben weiter Artikel. Wir wissen alle, dass wir jederzeit im Gefängnis landen können aber wir haben keine Angst davor verhaftet, geschlagen oder vielleicht sogar getötet zu werden. Warum sollten wir: In so vielen Teilen dieser Welt können Menschen so leben, wie sie sind. Das ist auch unser Recht und dafür kämpfen wir,“ sagt Hajar.
Einer der Fälle, der die Gruppe in den letzten Monaten am meisten beschäftigte, ist der von zwei 16- und 17 Jahre alten Mädchen aus Marrakesch. Im vergangenen Herbst hatte die Mutter einer der Beiden die Minderjährigen zur Polizei gebracht, da sie auf dem Handy ihrer Tochter ein Kuss-Foto der Freundinnen gefunden hatte. Daraufhin wurden die Mädchen festgenommen und verbrachten neun Tage im Gefängnis für Erwachsene, wo sie von homophoben Zellengenossinnen misshandelt wurden. Offiziell sieht das marokkanische Gesetz eine getrennte Unterbringung von Minderjährigen in Haft vor. Durch das veröffentlichen von Artikeln und Aufforderungen an internationale Organisationen machte Akaliyat, gemeinsam mit anderen Menschenrechtsgruppen, auf den Fall aufmerksam. Letztendlich führte das dazu, dass die Teenager wieder freigelassen wurden. Damit sei die Geschichte jedoch noch lange nicht erledigt gewesen. „Eines der Mädchen wurde von der Familie verstoßen, hat zwei Selbstmordversuche hinter sich und lebt seit mittlerweile vier Monaten auf der Straße. Wir versuchen ihr, so gut es geht, zu helfen,“ berichtet Hajar.
Das Gefühl, von der eigenen Familie im Stich gelassen zu werden, kennt auch Fatima. Während der drei Monate, die sie im Gefängnis verbrachte, wurden ihre Angehörigen in dem Glauben gelassen, dass man sie wegen Alkoholkonsum und Prostitution verhaftet habe. Für ihre extrem religiösen und konservativen Eltern sei die Scham so groß gewesen, dass sie nicht einmal den Mut aufbrachten, ihre Tochter zu besuchen. Im Gefängnis teilte Fatima sich eine Zelle mit insgesamt 18 Frauen. „Es gab nichts zu tun und nicht mal Decken zum Schlafen,“ erinnert sie sich. Deshalb vertrieb sie sich die Zeit, indem sie den vielen Analphabetinnen unter ihren Zellengenossinnen Lesen- und Schreiben beibrachte. Der Gefängnisverwaltung habe das überhaupt nicht gefallen und man habe sie für eine Stunde in Handschellen an eine Tür gehangen. „Ich habe trotzdem weitergemacht, denn ich habe die Frauen im Gefängnis wirklich geliebt“, sagt Fatima, die erstaunlicherweise ohne Verbitterung auf die Zeit zurückblickt und sagt, dass sie sogar dankbar für die Erfahrung ist, die sie so viel stärker gemacht hat. „Ich versuche immer, das Positive aus allem zu ziehen und in den drei Monaten habe ich erkannt, dass Frauen in Marokko nur aufgrund patriarchalischer Strukturen im Gefängnis sitzen.“